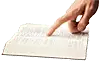Die Vulgata: Ein Meilenstein der biblischen Textgeschichte
Die Vulgata ist eine lateinische Bibelübersetzung aus dem späten 4. Jahrhundert. Sie wurde größtenteils von Hieronymus angefertigt, der im Jahr 382 von Papst Damasus I den Auftrag erhielt, die damals in der römischen Kirche verwendeten Gospels der Vetus Latina (eine frühe lateinische Bibelübersetzung) zu überarbeiten. Hieronymus erweiterte später aus eigenem Antrieb diese Überarbeitung auf fast alle Bücher der Bibel. Mit der Zeit wurde die Vulgata immer häufiger in der westlichen Kirche verwendet und ersetzte schließlich die Vetus Latina. Bis zum 13. Jahrhundert hatte sie sich als die allgemein gebräuchliche Version durchgesetzt, bekannt als „versio vulgata“ oder kurz „vulgata“. Sie beinhaltet auch einige Texte der Vetus Latina, an denen Hieronymus nicht gearbeitet hatte.
Im Laufe der Zeit wurde die Vulgata zur offiziell von der katholischen Kirche herausgegebenen lateinischen Bibelversion, beginnend mit der Sixtinischen Vulgata (1590), gefolgt von der Clementina Vulgata (1592) und schließlich der Nova Vulgata (1979). Die Vulgata wird bis heute in der lateinischen Kirche verwendet. Das Konzil von Trient erklärte sie zwischen 1545 und 1563 zur offiziellen lateinischen Bibel der katholischen Kirche, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keine autoritative Ausgabe gab. Die Clementina-Ausgabe wurde bis zur Herausgabe der Nova Vulgata im Jahr 1979 als der Standardtext der römischen Liturgie der katholischen Kirche verwendet.
Der Begriff „Vulgata“ wird seit dem 16. Jahrhundert ausschließlich für die lateinische Bibel verwendet. Ein Beispiel für die Verwendung dieses Begriffs zu dieser Zeit ist der Titel der lateinischen Bibelausgabe von Erasmus aus dem Jahr 1538: „Biblia utriusque testamenti juxta vulgatam translationem“.
Hieronymus' Übersetzungsarbeit: Einblick in sein Lebenswerk
Hieronymus, ein hochgelehrter Gelehrter des späten 4. Jahrhunderts, hatte ursprünglich nicht vor, eine neue Bibelversion zu erstellen. Sein Projekt entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit, wie aus seinem umfangreichen Briefwechsel hervorgeht. Im Jahr 382 wurde er von Papst Damasus I beauftragt, die Texte der vier Evangelien der Vetus Latina zu überarbeiten, um sie mit den besten griechischen Texten abzugleichen. Bis zum Tod von Damasus im Jahr 384 hatte Hieronymus diese Aufgabe abgeschlossen und zudem eine grobe Überarbeitung der Psalmen aus der Vetus Latina, basierend auf der griechischen Septuaginta, vorgenommen – eine Version, die er später ablehnte und die heute verloren ist.
Über die genauen Ausmaße seiner Überarbeitungen des restlichen Neuen Testaments lässt sich nur spekulieren, da keine seiner Arbeiten in diesen Büchern der Vulgata überlebt haben. Es wird angenommen, dass andere Gelehrte wie Rufinus von Aquileia oder Pelagius, ohne spezifische Beweise für eine direkte Beteiligung, diese Texte weiter bearbeitet haben. Diese unbekannten Bearbeiter stützten sich konsequent auf ältere griechische Manuskripte des alexandrinischen Texttyps und veröffentlichten bis spätestens 410 eine vollständig überarbeitete Fassung des Neuen Testaments.
In der Vulgata fasste Hieronymus die Bücher Esra und Nehemia zu einem Buch zusammen und verteidigte diese Entscheidung, obwohl er zuvor die Meinung vertrat, dass diese als zwei separate Bücher betrachtet werden könnten. Er argumentierte, dass die in der Septuaginta und der Vetus Latina gefundenen Versionen von Esdras lediglich „varianten Beispiele“ eines einzigen hebräischen Originals darstellten.
Die Vulgata wird oft als die erste Übersetzung des Alten Testaments ins Lateinische direkt aus dem hebräischen Tanach angesehen, nicht aus der griechischen Septuaginta. Hieronymus‘ umfangreiche Nutzung exegetischer Materialien in Griechisch, ebenso wie seine Verwendung der Aquilas und Theodotions Spalten der Hexapla, macht es schwierig, genau zu bestimmen, wie direkt die Übersetzung von Hebräisch zu Lateinisch war. Augustinus von Hippo, ein Zeitgenosse von Hieronymus, behauptete, dass Hieronymus eine Übersetzung direkt aus dem Hebräischen angefertigt habe, obwohl Augustinus auch die Septuaginta als inspirierten Text der Schrift anerkannte.
Vorworte und prologues
Hieronymus verfasste Vorworte zu einigen seiner Bibelübersetzungen, die seine Vorliebe für die „Hebraica veritas“ (die hebräische Wahrheit) über die Septuaginta zum Ausdruck bringen. Er betrachtete die Septuaginta teilweise als fehlerhaft, nicht nur aufgrund von Kopierfehlern, sondern auch wegen Fehlern im ursprünglichen Text selbst. Hieronymus glaubte, dass der hebräische Text Christus klarer vorwegnahm als die griechische Septuaginta. In seinen Vorworten verteidigte er diese Ansicht leidenschaftlich gegenüber seinen Kritikern.
Interessanterweise beinhalteten viele mittelalterliche Manuskripte der Vulgata Hieronymus‘ Brief an Paulinus, Bischof von Nola, als allgemeines Vorwort zur gesamten Bibel, was die Verbreitung des Glaubens förderte, dass der gesamte Text der Vulgata Hieronymus‘ Werk sei.
Diese detaillierte Betrachtung zeigt, dass Hieronymus‘ Beitrag zur Bibelübersetzung ein komplexes Unterfangen war, geprägt von gelehrten Untersuchungen und dem Bemühen, den Texten so treu wie möglich zu bleiben. Seine Arbeit legte den Grundstein für die Vulgata, die für Jahrhunderte maßgeblich die christliche Theologie und Praxis beeinflussen sollte.
Hieronymus und die Vetus Latina: Die Entwicklung der Vulgata
Vor der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung von Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert, gab es bereits lateinische Bibeltexte, bekannt als die Vetus Latina oder „Alte Lateinische Bibel“. Diese Texte entstanden nicht als einheitliches Werk, sondern wurden über Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Übersetzern angefertigt, was zu einer großen Vielfalt an Übersetzungsstilen und -qualitäten führte. Interessanterweise verwendete Hieronymus selbst für die Vetus Latina den Begriff „Lateinische Vulgata“, womit er diese als die gängige lateinische Umsetzung der griechischen Septuaginta bezeichnete.
Als Hieronymus mit der Überarbeitung der Evangelien begann, zielte er darauf ab, die bestehenden Vetus Latina-Texte mit den zuverlässigsten griechischen Manuskripten in Einklang zu bringen. Seine Revision war jedoch keine völlige Neuschöpfung, sondern eine sorgfältige Überarbeitung, bei der er die Reihenfolge der Evangelien an den griechischen Kanon anpasste und teilweise vom Vetus Latina und griechischen Text abwich, um bestimmte theologische Interpretationen widerzuspiegeln.
Interessanterweise unterschied sich der unbekannte Bearbeiter des restlichen Neuen Testaments deutlich von Hieronymus sowohl in der redaktionellen Praxis als auch in den Quellen. Während Hieronymus bestrebt war, den Text der Vetus Latina mithilfe der besten verfügbaren griechischen Manuskripte zu korrigieren, folgte die Überarbeitung des restlichen Neuen Testaments einem anderen griechischen Text, der dem Alexandrinischen Texttyp entsprach.
Für den Psalter, einen der am häufigsten verwendeten und kopierten Teile der christlichen Bibel, wurde Hieronymus ebenfalls beauftragt, die in Rom genutzte Version zu revidieren. Er distanzierte sich jedoch später von dieser Überarbeitung und behauptete, dass Kopisten fehlerhafte Lesarten wieder eingeführt hätten. Moderne Gelehrsamkeit hinterfragt, ob der überlebende römische Psalter tatsächlich Hieronymus‘ erste Revision darstellt.
Einige Bücher der Vulgata, wie Weisheit, Jesus Sirach, die Makkabäerbücher und Baruch (mit dem Brief des Jeremia), blieben reine Vetus Latina-Übersetzungen, die von Hieronymus unberührt waren. Im 9. Jahrhundert wurden die Vetus Latina-Texte von Baruch und dem Brief Jeremias in überarbeiteten Fassungen in die Vulgata aufgenommen.
Diese komplexe Beziehung zwischen der Vetus Latina und der Vulgata zeigt, wie Hieronymus‘ Arbeit auf den bestehenden Übersetzungen aufbaute und sie zugleich in einer Weise überarbeitete, die die Grundlage für den textuellen Standard der lateinischen Kirche für Jahrhunderte legte.
Die Vulgata im Kontext des Konzils von Trient und der katholischen Kirche
Das Konzil von Trient (1545–1563) verlieh der Vulgata eine offizielle Rolle innerhalb der katholischen Kirche, indem es sie als Maßstab für den biblischen Kanon und die kanonischen Teile der Bücher festlegte. Das Konzil erklärte die Vulgata zu einer authentischen Bibelausgabe, die in der Kirche für öffentliche Lesungen, Disputationen, Predigten und Auslegungen verwendet werden soll. Es betonte, dass die Vulgata aufgrund ihrer langjährigen Nutzung und Akzeptanz in der Kirche als authentisch gelten soll, und forderte, dass niemand sie unter irgendeinem Vorwand ablehnen dürfe.
Das Konzil legte fest, dass die Bücher des Kanons „in ihrer Gesamtheit mit allen ihren Teilen“ zu betrachten sind, wie sie in der Kirche gelesen wurden und wie sie in der Vulgata enthalten sind. Dabei wurden insgesamt 72 kanonische Bücher aufgelistet: 45 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament, wobei die Klagelieder nicht als von Jeremia getrennt gezählt wurden.
Später betonte Papst Pius XI., dass bestimmte Teile der Vulgata, wie das Comma Johanneum, zur Diskussion stehen dürfen. Im 20. Jahrhundert erklärte Papst Pius XII. in seiner Enzyklika „Divino Afflante Spiritu“, dass die Vulgata in Glaubens- und Moralfragen frei von jeglichem Irrtum sei. Diese Aussage bezieht sich jedoch nicht auf die philologische Genauigkeit, sondern auf die Verwendung der Vulgata in der Kirche über viele Jahrhunderte hinweg.
Die katholische Kirche hat drei offizielle Ausgaben der Vulgata herausgegeben: die Sixtinische Vulgata, die Clementina Vulgata und die Nova Vulgata. Diese Entwicklungen zeigen die Bedeutung der Vulgata nicht nur als biblischer Text, sondern auch als ein zentrales Element der kirchlichen Tradition und Lehre.
Die Prägende Wirkung der Vulgata auf das westliche Christentum
Die Vulgata war von etwa 400 n. Chr. bis 1530 n. Chr. das am weitesten verbreitete Buch in der westeuropäischen Gesellschaft. Für die meisten Christen im Westen, insbesondere Katholiken, war sie über Jahrhunderte hinweg die einzige bekannte Bibelversion. Ihre vorherrschende Stellung begann erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu schwinden.
Einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Vulgata markiert das Jahr 1455, als Johannes Gutenberg und der Bankier Johann Fust in Mainz die erste mittels beweglicher Lettern gedruckte Vulgata herstellten. Zu dieser Zeit konnte ein Manuskript der Vulgata etwa 500 Gulden kosten. Trotz der revolutionären Technik war Gutenbergs Projekt finanziell nicht erfolgreich, und Fust erlangte durch eine Klage die vollständige Kontrolle über Gutenbergs Druckerei. Es wird oft argumentiert, dass die Reformation ohne die Verbreitung biblischen Wissens durch den Buchdruck nicht möglich gewesen wäre.
Die Vulgata diente nicht nur für Gebet, Liturgie und persönliches Studium, sondern inspirierte auch kirchliche Kunst und Architektur, Hymnen, unzählige Gemälde und beliebte Mysterienspiele.
Zur Zeit der Reformation beinhaltete der fünfte Band von Waltons Londoner Polyglotbibel von 1657 verschiedene Versionen des Neuen Testaments in Sprachen wie Griechisch, Latein (darunter eine Vulgata-Version), Syrisch, Äthiopisch und Arabisch, sowie eine Version der Evangelien auf Persisch.
Die Vulgata wurde regelmäßig in Werken wie Thomas Hobbes‘ „Leviathan“ von 1651 verwendet, wobei Hobbes dazu neigte, die Vulgata als den Originaltext zu behandeln.
Vor der Veröffentlichung von Pius XII. Enzyklika „Divino afflante Spiritu“ diente die Vulgata als Grundlage für viele Übersetzungen der Bibel in Volkssprachen. So basieren unter anderem die interlineare Übersetzung der Lindisfarne-Evangelien, die Übersetzung von John Wycliffe, die Douay-Rheims-Bibel, die Confraternity-Bibel und die Übersetzung von Ronald Knox auf der Vulgata.
Die Vulgata hatte auch einen bedeutenden kulturellen Einfluss auf die Literatur und trug zur Entwicklung der englischen Sprache bei, insbesondere in religiösen Angelegenheiten. Viele lateinische Wörter fanden fast unverändert Eingang in die englische Sprache, darunter „creatio“, „salvatio“, „justificatio“, „testamentum“, „sanctificatio“, „regeneratio“ und „raptura“. Weitere Beispiele sind „apostolus“, „ecclesia“, „evangelium“, „Pascha“ und „angelus“.
Die Vulgata: Ein Meilenstein in der Geschichte der Bibelkritik
Im späten 4. Jahrhundert nahm sich Hieronymus der Aufgabe an, die 38 Bücher der Hebräischen Bibel ins Lateinische zu übersetzen, wobei er Esra und Nehemia als ein Buch behandelte. Diese Arbeit gab ihm die Möglichkeit, sich frei mit dem Text auseinanderzusetzen, besonders da es zu seiner Zeit noch keinen einheitlich standardisierten hebräischen Text gab. Die damaligen Textüberlieferungen der Hebräischen Bibel waren vielfältig und nicht vollständig konsolidiert.
Die ältesten komplett erhaltenen Manuskripte des Masoretischen Textes, die erst rund 600 Jahre nach Hieronymus erstellt wurden, bieten einen Einblick in die Textbasis, die Hieronymus für seine Übersetzungen nutzte. Diese Texte, sorgfältig überliefert von den Masoreten zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert, zeichnen sich durch ein ausgeklügeltes System von Vokalisierungs- und Akzentzeichen aus, das entwickelt wurde, um die korrekte Aussprache und Betonung des Hebräischen sicherzustellen.
Hieronymus unterschied sich in seinem Ansatz deutlich von den Methoden der Masoreten. Statt sich auf eine buchstabengetreue Überlieferung zu konzentrieren, lag sein Fokus darauf, die Bedeutung und den Sinn der hebräischen Schriften in das Lateinische zu übertragen. Dabei bezog er sich nicht nur auf den hebräischen Text, sondern zog auch die griechische Septuaginta sowie andere frühe Übersetzungen heran.
Diese methodologischen Unterschiede verdeutlichen die Komplexität der biblischen Textgeschichte und betonen die bedeutende Rolle der Vulgata in der bibelkritischen Forschung. Hieronymus‘ Übersetzungen bieten wertvolle Einblicke in den Stand der Hebräischen Bibel vor der Standardisierung durch die Masoreten und illustrieren, wie die heiligen Schriften von den frühen Christen interpretiert und verstanden wurden.
Die Vulgata, als eines der ersten vollständigen Bibelübersetzungen ins Lateinische, ist nicht nur ein zentrales Dokument der christlichen Geistesgeschichte, sondern auch ein entscheidendes Werkzeug für die moderne biblische Kritik und Textforschung. Der Vergleich der Vulgata mit dem Masoretischen Text und anderen antiken Übersetzungen ermöglicht es Gelehrten, die Entwicklungsgeschichte der biblischen Texte nachzuvollziehen und ein tieferes Verständnis für die Überlieferung der Bibel zu erlangen.
Jesaja 7:14 – Die Entscheidung für „virgo“
Hieronymus‘ Entscheidung, das hebräische Wort „עלמה“ (almah) in Jesaja 7:14 mit „virgo“ (Jungfrau) zu übersetzen, reflektiert seine Absicht, die christliche Interpretation der Schrift zu unterstützen. Diese Wahl steht im Einklang mit der LXX und dem Matthäusevangelium, wo diese Prophezeiung zur Untermauerung der Jungfrauengeburt Jesu herangezogen wird.
Psalm 22:16 – Eine christologische Interpretation
Auch bei Psalm 22:16 (21:17 in der Vulgata) entschied sich Hieronymus für eine Übersetzung, die „sie durchbohrten meine Hände und meine Füße“ lautet, und folgte damit eher der LXX als dem hebräischen Text. Diese Entscheidung unterstreicht sein Bestreben, die Schriften im Lichte der christlichen Theologie zu deuten.
Diese Beispiele unterstreichen, wie Hieronymus durch seine Übersetzungen nicht nur eine Brücke zwischen den originalen hebräischen Texten und dem lateinischsprachigen Christentum baute, sondern auch eine tiefe theologische Dimension in die Vulgata einfließen ließ. Seine Arbeit zeigt das ausgewogene Zusammenspiel zwischen Texttreue und der Notwendigkeit, die biblischen Schriften im Kontext des christlichen Glaubens verständlich und relevant zu machen.
Entwicklung und Bedeutung der Vulgata: Schlüsselmomente
Hieronymus erhält Auftrag
| Hieronymus wird von Papst Damasus I beauftragt, die Gospels der Vetus Latina zu überarbeiten. |
Überarbeitung der Evangelien
Hieronymus schließt die Überarbeitung der vier Evangelien ab und beginnt mit der Psalmenüberarbeitung.
Erweiterung der Überarbeitung
Hieronymus erweitert die Überarbeitung auf fast alle Bücher der Bibel.
Vulgata setzt sich durch
Die Vulgata ersetzt die Vetus Latina und wird zur allgemein gebräuchlichen Version.
Gutenberg-Bibel
Erste mittels beweglicher Lettern gedruckte Ausgabe der Vulgata.
Konzil von Trient
Die Vulgata wird zur offiziellen lateinischen Bibel der katholischen Kirche erklärt.
Sixtinische Vulgata
Veröffentlichung der ersten offiziellen lateinischen Bibelausgabe der Katholischen Kirche.
Clementina Vulgata
Ersatz der Sixtinischen durch die Clementina Vulgata; wird Standardtext bis 1979.
Nova Vulgata
Veröffentlichung als die neueste offizielle Bibel der Katholischen Kirche.
Wegweisende Manuskripte und Editionen der Vulgata
Die Vulgata, die lateinische Übersetzung der Bibel, zählt zu den bedeutsamsten religiösen Texten der Christenheit und ist in verschiedenen Ausführungen überliefert. Hier sind einige der markantesten Manuskripte und Editionen aufgeführt:
- Codex Amiatinus: Dieses Manuskript aus dem 8. Jahrhundert gilt als das älteste vollständig erhaltene Exemplar der Vulgata. Seine Bedeutung liegt nicht nur in seinem Alter, sondern auch in der Qualität der Textüberlieferung.
- Gutenberg-Bibel (1455): Die von Johann Gutenberg gedruckte Ausgabe ist die erste gedruckte Version der Vulgata und markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Buchdrucks. Diese Edition machte die Bibel einem breiteren Publikum zugänglich und leitete eine neue Ära in der Verbreitung religiöser Texte ein.
- Sixtinische Vulgata (1590): Als erste offizielle Bibelausgabe der Katholischen Kirche eingeführt, spielte diese Edition eine wichtige Rolle in der Standardisierung des biblischen Textes für die katholische Liturgie.
- Clementine Vulgata (1592): Diese Edition folgte der Sixtinischen Vulgata und diente als standardisierte Ausgabe der mittelalterlichen Vulgata. Sie wurde zur zweiten offiziellen Bibel der Katholischen Kirche und prägte über Jahrhunderte hinweg die Verwendung der heiligen Schriften in der katholischen Praxis.
- Stuttgarter Vulgata (1969): Diese kritische Ausgabe wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft veröffentlicht und basiert auf einer sorgfältigen Prüfung sowohl der historischen Manuskripte als auch der früheren Druckausgaben. Sie zielt darauf ab, einen Text nahe am ursprünglichen Wortlaut der Vulgata zu bieten.
- Nova Vulgata (1979): Die neueste offizielle Bibel der Katholischen Kirche, übersetzt in klassisches Latein basierend auf modernen kritischen Ausgaben der ursprünglichen Bibeltexte. Diese Ausgabe reflektiert den aktuellen Stand der bibelwissenschaftlichen Forschung und ist in der Liturgie der lateinischen Kirche von zentraler Bedeutung.
Jede dieser Ausgaben der Vulgata hat auf ihre Weise zur Bewahrung, Standardisierung und Verbreitung der Heiligen Schrift beigetragen. Von den frühesten Handschriften bis hin zu den neuesten offiziellen Editionen spiegeln sie die dynamische Geschichte der Bibelübersetzung und -nutzung im christlichen Glauben wider.