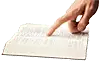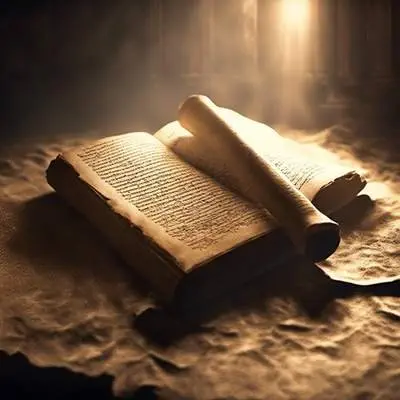Die Septuaginta: Einflussreiche Griechische Übersetzung der Hebräischen Bibel
Die Septuaginta, bekannt als LXX, ist eine essenzielle griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., entstanden in Alexandria, Ägypten. Sie umfasst nicht nur den hebräischen Kanon, sondern integriert auch apokryphe Schriften, die in vielen christlichen Traditionen anerkannt sind. Diese Sammlung beeinflusste die Verbreitung jüdischer Schriften im hellenistischen Raum und prägte das frühe Christentum, da die Apostel und Neutestamentlichen Autoren oft daraus zitierten. Trotz späterer Ablösung durch die Vulgata in der westlichen Kirche bleibt die Septuaginta in der orthodoxen Christenheit zentral. Ihre textuelle und theologische Untersuchung bietet tiefe Einblicke in die biblische Überlieferung.
Inhalt
Die Septuaginta LXX
Die Septuaginta, auch bekannt als die griechische Übersetzung des Alten Testaments oder als die Übersetzung der Siebzig, ist die älteste erhaltene griechische Übersetzung der hebräischen Bibel aus dem Originalhebräisch. Der vollständige griechische Titel leitet sich von der Geschichte ab, die im Brief des Aristeas an Philokrates aufgezeichnet ist. Dort wird berichtet, dass „die Gesetze der Juden“ auf Wunsch von Ptolemaios II. Philadelphos (285-247 v. Chr.) von zweiundsiebzig (oder siebzig) hebräischen Übersetzern – je sechs aus den zwölf Stämmen Israels – ins Griechische übersetzt wurden.
Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel wahrscheinlich im frühen oder mittleren Teil des 3. Jahrhunderts v. Chr. von Juden im ptolemäischen Königreich vom biblischen Hebräisch ins Koiné-Griechisch übersetzt wurden. Die restlichen Bücher wurden vermutlich im 2. Jahrhundert v. Chr. übersetzt. Die Septuaginta erfüllte daher ein Bedürfnis in der jüdischen Gemeinschaft, da nur wenige Menschen die hebräische Sprache sprechen oder lesen konnten. Der Begriff „Septuaginta“ leitet sich von der lateinischen Phrase „Vetus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum“ ab, was „Das Alte Testament aus der Übersetzung der siebzig Übersetzer“ bedeutet. Erst zur Zeit des Augustinus von Hippo (354-430 n. Chr.) wurde es als die griechische Übersetzung der jüdischen Schriften bezeichnet. Die römische Zahl LXX (siebzig) wird häufig als Abkürzung verwendet. Die Septuaginta besteht aus verschiedenen griechischen Übersetzungen des Tanach, zusammen mit anderen jüdischen Texten, die heute oft als Apokryphen bezeichnet werden. Es gibt Unterschiede zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text, der Grundlage des heutigen jüdischen Tanach ist, sowie dem lateinischen Vulgata-Text, der von der römisch-katholischen Kirche verwendet wird. Die Septuaginta hat auch Einfluss auf andere christliche Übersetzungen des Alten Testaments gehabt und bildet die Grundlage für Versionen in slawischer, syrischer, altarmenischer, altgeorgischer und koptischer Sprache.
Etymologie
Die Etymologie des Begriffs „Septuaginta“ ist interessant. Der Name stammt von der lateinischen Phrase „Vetus Testamentum ex versione Septuaginta Interpretum“, was „Das Alte Testament aus der Übersetzung der Siebzig Übersetzer“ bedeutet. Der Titel „Septuaginta“ geht auf die Geschichte zurück, die im Brief des Aristeas an Philokrates beschrieben wird. Dort wird erzählt, dass König Ptolemaios II. Philadelphos im dritten Jahrhundert vor Christus 72 hebräische Übersetzer nach Alexandria geschickt hat, um die Gesetze der Juden ins Griechische zu übertragen. Der Name „Septuaginta“ bezieht sich auf die Zahl 70, da einige Versionen behaupten, dass 70 Übersetzer beteiligt waren. Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Anzahl der beteiligten Übersetzer nicht historisch belegt ist. Trotzdem hat sich der Begriff „Septuaginta“ im Laufe der Zeit etabliert und wird heute verwendet, um die griechische Übersetzung des Alten Testaments zu bezeichnen.
Jüdische Legende
Gemäß der jüdischen Legende wurde die Septuaginta auf Anweisung des ägyptischen Pharaos Ptolemaios II. Philadelphos von 72 jüdischen Gelehrten übersetzt. Diese Gelehrten kamen aus den zwölf Stämmen Israels und wurden von Jerusalem nach Alexandria geschickt. Der Legende nach wurden sie in 72 getrennten Räumen untergebracht, ohne zu wissen, warum sie gerufen wurden. Der Pharao betrat jeden Raum und forderte die Gelehrten auf, die Tora, das heilige Gesetz der Juden, in die griechische Sprache zu übersetzen. Erstaunlicherweise übersetzten alle 72 Gelehrten das hebräische Original genau auf die gleiche Weise. Diese außergewöhnliche Einheitlichkeit der Übersetzung wurde als göttliches Wunder betrachtet.

Die Geschichte der Übersetzung der Septuaginta wird in verschiedenen Quellen überliefert, darunter der Brief von Aristeas an Philokrates und Schriften von Philo von Alexandria und Josefus. Später wurde sie auch von Augustinus von Hippo erwähnt. Die jüdische Tradition hielt die Septuaginta jedoch nicht für eine authentische und geeignete Übersetzung der hebräischen Bibel. Sie betrachtete die Übersetzung als Verfälschung des heiligen Textes und ungeeignet für den Gebrauch in der Synagoge.
Dennoch bleibt die Geschichte der Septuaginta eine faszinierende Legende, die die Bedeutung und den Einfluss dieser griechischen Übersetzung des Alten Testaments betont.
Geschichte
Die Bedeutung der Septuaginta für das Verständnis des Alten Testaments ist enorm. Die Übersetzung ins Griechische begann im 3. Jahrhundert vor Christus und erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte. Es ist allerdings unklar, in welcher genauen Reihenfolge und an welchen Orten die Übersetzungen stattfanden.
Es wird angenommen, dass die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel, die Tora, zuerst ins Griechische übersetzt wurden. Diese Übersetzung spiegelt sich in der Qualität des Griechischen wider, das dem frühen Koiné-Griechisch ähnlich ist. Im Laufe der Zeit wurden auch andere Bücher nach und nach übersetzt. Es ist jedoch unklar, zu welchem Zeitpunkt welche Bücher übersetzt wurden und ob es möglicherweise mehrere Versionen der Übersetzungen gab.
Die Qualität der Übersetzungen differiert von Buch zu Buch. Einige sind wortgetreue Übersetzungen, während andere eher frei interpretiert sind. Es existieren auch verschiedene Stile und theologische Schwerpunkte in den verschiedenen Übersetzungen.
Die Septuaginta hatte einen bedeutenden Einfluss auf die damalige jüdische Gemeinschaft. Zu der Zeit, als Hebräisch nur noch von wenigen Menschen gesprochen oder gelesen wurde, war Griechisch die vorherrschende Sprache im östlichen Mittelmeerraum. Aus diesem Grund erfüllte die Septuaginta ein Bedürfnis in der jüdischen Gemeinschaft, da sie es den Menschen ermöglichte, die heiligen Texte in ihrer eigenen Sprache zu lesen und zu verstehen.
Die Septuaginta gewann auch in den frühen christlichen Gemeinden an Bedeutung, als das Christentum verbreitet wurde. Die Apostel und ihre Anhänger zitierten oft aus der Septuaginta, was darauf hindeutet, dass sie diese griechische Übersetzung als vertrauenswürdig betrachteten.
Im Laufe der Zeit gab es verschiedene Überarbeitungen und Überarbeitungen der Septuaginta. Es entstanden unterschiedliche griechische Versionen, die von verschiedenen jüdischen und später auch christlichen Gemeinschaften genutzt wurden.
Die Septuaginta hatte einen bedeutenden Einfluss auf spätere Übertragungen des Alten Testaments in andere Sprachen wie Latein, Syrisch, Armenisch, Georgisch und Koptisch.
Alles in allem ist die Geschichte der Septuaginta ein spannendes Kapitel in der Entstehung und Verbreitung des Alten Testaments und hat immer noch einen wichtigen Stellenwert in der jüdischen und christlichen Tradition.
Sprache
Die Septuaginta, eine Übersetzung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische, wurde in der griechischen Sprache verfasst. In einigen Abschnitten gibt es semitische Einflüsse, das bedeutet, dass Wendungen und Ausdrücke aus semitischen Sprachen wie Hebräisch und Aramäisch verwendet werden. Andere Bücher wie Daniel und Sprüche zeigen dagegen eine stärkere griechische Prägung.
Die Septuaginta ermöglicht uns auch ein besseres Verständnis der Aussprache des vor-masoretischen Hebräisch. In der Übersetzung werden viele Eigennamen mit griechischen Vokalen geschrieben, während die zeitgenössischen hebräischen Texte keine Vokalpunkte hatten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass alle Laute des biblischen Hebräisch genaue griechische Entsprechungen hatten.
Die griechische Übersetzung der Bibel, die Septuaginta, weist auch einige Unterschiede zur lateinischen Vulgata und zum masoretischen Text auf, der als Grundlage für den hebräischen Tanach dient. Diese Unterschiede können verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel unterschiedliche hebräische Quellen oder idiomatische Übersetzungsprobleme. Außerdem könnten sie auf Überarbeitungen und Kopierfehler während der Überlieferung zurückzuführen sein.
In ihrer Gesamtheit stellt die griechische Sprache der Septuaginta ein bedeutsames Element ihrer Zusammensetzung dar und beeinflusst unsere jetzige Auslegung des Alten Testaments.
Differenzen zwischen Septuaginta und masoretischen Text
Es gibt bestimmte Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text. Der masoretische Text bildet die Grundlage für den heutigen hebräischen Tanach, während die Septuaginta eine griechische Übersetzung des Alten Testaments ist. Diese Unterschiede betreffen sowohl den Inhalt als auch die Anordnung der Bücher.
Der masoretische Text ist in drei Teile unterteilt: die Tora (Gesetz), die Nevi’im (Propheten) und die Ketuvim (Schriften). Im Gegensatz dazu ist die Septuaginta in vier Teile aufgeteilt: Gesetz, Geschichte, Poesie und Propheten. Die apokryphen Bücher wurden entsprechend in die Septuaginta eingefügt.
Die Septuaginta beinhaltet auch weitere Bücher, die im masoretischen Text nicht vorhanden sind. Diese Bücher werden als zweites Kanon oder apokryphe Bücher bezeichnet. Darunter fallen zum Beispiel Tobit, Judit, die Weisheit des Salomos, Sirach und die Bücher der Makkabäer. Diese Bücher wurden zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 1. Jahrhundert nach Christus verfasst.
Einige der zusätzlichen Bücher haben längere Versionen als der masoretische Text, wie zum Beispiel das Buch Daniel. Andere hingegen sind kürzer, wie zum Beispiel das Buch Jeremia.
Es ist von Bedeutung zu beachten, dass die Aufnahme dieser zusätzlichen Bücher in die Septuaginta von verschiedenen christlichen Traditionen unterschiedlich beurteilt wird. Die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche nehmen die meisten dieser Bücher in ihre Bibel auf, während protestantische Kirchen dies in der Regel nicht tun.
Die Unterschiede zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text stellen ein faszinierendes Phänomen dar und zeigen die Vielfalt der Überlieferung und Auslegung des Alten Testaments. Sie haben auch Einfluss auf die aktuelle Praxis und Auslegung sowohl in der jüdischen als auch christlichen Tradition.
Finale Form
Die endgültige Gestalt der Septuaginta weist einige spezielle Merkmale auf. Alle Bücher, die im westlichen Alten Testament enthalten sind, sind auch in der Septuaginta vorhanden, jedoch nicht immer in derselben Reihenfolge. Die Septuaginta hat eine eigene Anordnung der Bücher, die sich in den frühesten christlichen Bibeln des 4. Jahrhunderts widerspiegelt.
Einige Bücher, die im masoretischen Text als separate Bücher angesehen werden, sind in der Septuaginta zusammengefasst. Zum Beispiel sind die Bücher Samuel und die Bücher der Könige zu einem Buch mit dem Titel „Der König“ zusammengefasst. Die Bücher der Chronik, die im masoretischen Text als zwei separate Bücher gelten, werden in der Septuaginta als „Die Dinge, die übrig blieben“ zusammengefasst. Die zwölf kleinen Propheten werden in der Septuaginta als ein Buch mit dem Titel „Die Zwölf“ präsentiert.
Einige antike Texte sind in der Septuaginta vorhanden, aber nicht im hebräischen Tanach. Zu diesen zusätzlichen Büchern gehören zum Beispiel Tobit, Judit, Weisheit Salomos, Jesus Sirach, Baruch und Epistel Jeremias. Es gibt auch Erweiterungen zu den Büchern Ester und Daniel. Einige dieser Bücher werden von einigen Gemeinschaften als deuterokanonisch oder apokryph betrachtet.
Es ist bemerkenswert festzustellen, dass es in einigen Fällen Abweichungen zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text gibt. Einige Bücher sind in der Septuaginta länger als im masoretischen Text, wie beispielsweise das Buch Daniel, während das Buch Jeremia in der Septuaginta kürzer ist.
Die Septuaginta beeinflusst das Verständnis des Alten Testaments innerhalb verschiedener christlicher Traditionen stark und wird oft als Grundlage für Übersetzungen in andere Sprachen genutzt. Es ist wichtig zu beachten, dass ihre definitive Form nicht einheitlich ist und dass verschiedene Handschriften unterschiedliche Inhalte enthalten können.
Die Variationen zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text reflektieren die Entwicklung des Alten Testaments über die Zeit und die Vielfältigkeit der Überlieferungstraditionen. Sie beeinflussen ebenfalls die kanonische Anerkennung der Bücher in unterschiedlichen religiösen Traditionen.
Theodotion´s Übersetzung
Die Übersetzung des Theodotion spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der Septuaginta. Im Buch Daniel gibt es zwei verschiedene Versionen in der Septuaginta: die ursprüngliche Version, die um 100 v. Chr. entstanden ist, und die spätere Version des Theodotion aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Diese beiden griechischen Texte weichen in einigen Abschnitten voneinander ab.
Die Theodotion-Version des Buches Daniel ähnelt in vielen Aspekten mehr dem masoretischen Text als der ursprünglichen Septuaginta-Version. Daher wurde die Theodotion-Version zur vorherrschenden Fassung von Daniel in den meisten Handschriften der Septuaginta. Im Gegensatz dazu wurde die ursprüngliche Septuaginta-Version nur in zwei Handschriften der Septuaginta entdeckt.
Die 12 Kapitel des Buches Daniel sind in der masoretischen Textversion und in zwei längeren griechischen Versionen erhalten: der ursprünglichen Septuaginta-Version aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. und der späteren Theodotion-Version aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Beide griechischen Texte enthalten drei Ergänzungen zum Buch Daniel: das Gebet des Asarja und das Loblied der drei Jünglinge, die Geschichte von Susanna und die Geschichte von Bel und dem Drachen. Die Theodotion-Version ähnelt dem masoretischen Text sehr und wurde so beliebt, dass sie in fast allen Handschriften der Septuaginta die ursprüngliche Septuaginta-Version ersetzte. Die griechischen Ergänzungen waren offenbar nie Teil des hebräischen Textes. Verschiedene alte griechische Texte des Buches Daniel wurden entdeckt und die ursprüngliche Form des Buches wird rekonstruiert.
Die Gründe für das Entstehen der Theodotion-Version sind nicht eindeutig geklärt. Es wird vermutet, dass Theodotion eine neue griechische Übersetzung erstellt hat, um den masoretischen Text genauer wiederzugeben und die Schwierigkeiten in der ursprünglichen Septuaginta-Version zu überwinden. Die Theodotion-Version wurde von der Kirche weitgehend akzeptiert und fand Eingang in die meisten Septuaginta-Handschriften.
Es ist von Bedeutung zu erwähnen, dass die Theodotion-Version nicht nur im Buch Daniel zu finden ist, sondern auch in anderen Teilen des Alten Testaments. In einigen Fällen wurde die Theodotion-Version sogar als bevorzugte Version gegenüber der ursprünglichen Septuaginta-Version angesehen.
Der Vergleich zwischen der Theodotion-Version und der ursprünglichen Septuaginta-Version von Daniel illustriert die Komplexität und Vielfalt der Überlieferung des Alten Testaments. Zudem verdeutlichen sie den Einfluss unterschiedlicher Übersetzungen und Revisionen im Laufe der Zeit.
Die Theodotion-Version des Buches Daniel hat ingesamt einen wichtigen Stellenwert in der Geschichte der Septuaginta eingenommen und prägt bis heute unser Verständnis dieses biblischen Buches.
Christliche Nutzung
In der frühen Kirche wurde die Septuaginta weit verbreitet verwendet, da Griechisch zu dieser Zeit die lingua franca des Römischen Reiches und die Sprache der griechisch-römischen Kirche war. Das Verhältnis zwischen der apostolischen Verwendung der Septuaginta und den hebräischen Texten ist komplex. Obwohl die Septuaginta den Anschein erweckte, eine wichtige Quelle für die Apostel zu sein, war sie nicht die einzige. Zum Beispiel führte Jerome, der das Alte Testament in seiner Vulgata übersetzte, Matthäus 2:15 und 2:23, Johannes 19:3 und 1 Korinther 2:9 als Beispiele an, die in hebräischen Texten zu finden waren, aber nicht in der Septuaginta. Matthäus 2:23 ist auch nicht im aktuellen masoretischen Text enthalten; laut Jerome befand es sich jedoch in Jesaja 11:1. Die ersten nicht-jüdischen Christen nutzten die Septuaginta aus der Notwendigkeit heraus, da sie die einzige griechische Version der Bibel war und die meisten (wenn nicht alle) dieser frühen nicht-jüdischen Christen kein Hebräisch lesen konnten. Die Assoziation der Septuaginta mit einer konkurrierenden Religion könnte sie jedoch in den Augen der jüngeren Generation von Juden und jüdischen Gelehrten verdächtig gemacht haben. Juden verwendeten stattdessen hebräische oder aramäische Targum-Manuskripte, die später von den Masoreten und autoritativen aramäischen Übersetzungen wie denen von Onkelos und Rabbi Yonathan ben Uziel zusammengestellt wurden. Vielleicht am bedeutendsten war, dass die Septuaginta im Gegensatz zu anderen griechischen Versionen angeblich die jüdische Zustimmung verlor, nachdem Unterschiede zwischen ihr und zeitgenössischen hebräischen Schriften entdeckt wurden. Sogar griechischsprachige Juden bevorzugten anscheinend andere griechische jüdische Versionen (wie die Übersetzung von Aquila), die scheinbar besser mit zeitgenössischen hebräischen Texten übereinstimmten.
Textanalyse
Die Untersuchung des Textes der Septuaginta beinhaltet einen Vergleich mit dem Masoretischen Text und der Vulgata. Es gibt Differenzen zwischen den Texten, die in vier Kategorien klassifiziert werden können:
Es gibt diverse hebräische Quellen für den Masoretischen Text und die Septuaginta. Diese Unterschiede sind im gesamten Alten Testament vorhanden und können auf verschiedene hebräische Vorlagen zurückgeführt werden.
Es gibt verschiedene Auslegungen, die auf demselben hebräischen Text basieren. Ein Beispiel dafür ist Genesis 4:7, bei dem die Septuaginta andere Wörter verwendet als der masoretische Text, aber die gleiche Bedeutung vermittelt.
Unterschiede entstehen aufgrund von idiomatischen und übersetzungsbedingten Fragen. Es kommt oft vor, dass hebräische Redewendungen nicht einfach ins Griechische übertragen werden können, was zu Veränderungen in der Formulierung führt.
Änderungen in der Überlieferung im Hebräischen oder Griechischen, darunter Revisionen oder Fehler beim Kopieren.
Die ältesten Manuskripte der Septuaginta stammen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 5. Jahrhundert nach Christus. Sie belegen, dass die Texte im Laufe der Zeit auseinander gingen aufgrund von jüdischen und späteren christlichen Überarbeitungen und Revisionen.
Die Unterschiede zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text werden oft damit erklärt, dass verschiedene hebräische Quellen, unterschiedliche Interpretationen, Übersetzungsfragen und Veränderungen in der Überlieferung verwendet wurden. Forschungen haben gezeigt, dass weder die eine noch die andere Version per se „richtig“ oder „falsch“ ist, sondern dass sie verschiedene Traditionen und Überlieferungen reflektieren.
Jüdische Nutzung
Es ist unklar, wie die Juden in Alexandria die Autorität der Septuaginta akzeptierten. Unter den Schriftrollen vom Toten Meer wurden Manuskripte der Septuaginta gefunden, die zu dieser Zeit von verschiedenen jüdischen Sekten verwendet wurden. Jedoch führten mehrere Faktoren dazu, dass die meisten Juden im 2. Jahrhundert n.Chr. die Septuaginta aufgaben. Die frühen nicht-jüdischen Christen verwendeten die Septuaginta aus der Notwendigkeit heraus, da dies die einzige griechische Version der Bibel war und die meisten (wenn nicht alle) dieser frühen nicht-jüdischen Christen kein Hebräisch lesen konnten. Die Verbindung der Septuaginta mit einer konkurrierenden Religion könnte sie jedoch in den Augen der neueren Generation von Juden und jüdischen Gelehrten verdächtig gemacht haben. Anstatt dessen verwendeten Juden hebräische oder aramäische Targum-Manuskripte, die später von den Masoreten und autoritativen aramäischen Übersetzungen wie denen von Onkelos und Rabbi Yonathan ben Uziel zusammengestellt wurden. Vielleicht am bedeutsamsten für die Septuaginta im Gegensatz zu anderen griechischen Versionen war, dass sie jüdische Zustimmung verlor, nachdem Unterschiede zwischen ihr und zeitgenössischen hebräischen Schriften entdeckt wurden. Sogar griechischsprachige Juden bevorzugten andere jüdische Versionen auf Griechisch (wie die Übersetzung von Aquila), die anscheinend besser mit zeitgenössischen hebräischen Texten übereinstimmten.
Qumran: Einblick in die Septuaginta
Die Schriftrollen des Toten Meeres sind eine wichtige Entdeckung, die zur Erforschung und Erweiterung unseres Verständnisses des Alten Testaments beigetragen hat. Unter den gefundenen Schriftrollen gibt es auch Bruchstücke der Septuaginta. Diese Bruchstücke liefern uns einen Einblick in die Vielfalt der Textvarianten und Überlieferungen.
Einige der gefundenen hebräischen Fragmente stammen aus Büchern, die auch in der Septuaginta enthalten sind, wie zum Beispiel Daniel und Tobit. Es gibt auch ein Fragment des Psalms 151, das in einigen Ausgaben der Septuaginta zu finden ist. Darüber hinaus wurde das Buch Sirach (auch bekannt als Jesus Sirach oder Ben Sira) in hebräischer Sprache entdeckt, was darauf hindeutet, dass es bereits vor der Septuaginta existierte.
Durch das Auffinden dieser Bruchstücke haben wir die Möglichkeit, den Vergleich zwischen den hebräischen Texten und der griechischen Septuaginta genauer zu erforschen. Es wird auch deutlich, dass es verschiedene Versionen und Überarbeitungen der Texte gab, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
Die Schriftrollen des Toten Meeres sind ein kostbares Zeugnis für die Mannigfaltigkeit und Entwicklung der biblischen Texttraditionen. Sie haben uns ermöglicht, die Präzision und Verlässlichkeit der biblischen Texte weiter zu erforschen und unser Verständnis des Alten Testaments zu vertiefen.
Die oben genannten Ausschnitte wurden in Höhle 4 des Qumran-Gebiets entdeckt. Sie sind bedeutende Belege für das Vorhandensein und die Nutzung der Septuaginta während der Zeit der Schriftrollengemeinschaft.
Das Fragment 4QLXXLev (4Q120) beinhaltet Auszüge des Buches Leviticus in der Septuaginta-Version. Es wurde in der Höhle 4 gefunden.
4QLXXNum (4Q121): Dieses Stück enthält Abschnitte des Buches Numeri in der Septuaginta-Version. Es wurde auch in Höhle 4 entdeckt.
4QLXXDeut (4Q123): Dieser Ausschnitt enthält Abschnitte des Buches Deuteronomium in der Septuaginta-Version. Es wurde in Höhle 4 gefunden.
Septuaginta & Masoretischer Text: Nuancen & Gemeinsamkeiten
Die Unterschiede zwischen der Septuaginta (LXX) und dem Masoretischen Text (MT) umfassen eine Vielzahl von Aspekten, die von der Textstruktur über theologische Interpretationen bis hin zu sprachlichen Eigenheiten reichen. Eine vollständige Detailanalyse aller Unterschiede würde den Rahmen sprengen, aber ich werde auf einige Schlüsselpunkte eingehen, die die Kernunterschiede und deren potenzielle Gründe beleuchten.
Kanonische Unterschiede
- Zusätzliche Bücher: Die LXX umfasst Texte, die im MT nicht enthalten sind, wie z.B. die Bücher der Makkabäer, Tobit, Judith, Weisheit Salomos, Sirach (Ekklesiastikus), Baruch, den Brief des Jeremia sowie Zusätze zu Ester und Daniel.
- Grund für diese Differenz ist, dass die LXX eine breitere Sammlung jüdischer Schriften aus der hellenistischen Periode darstellt, die in der jüdischen Diaspora verwendet wurden, während der Kanon des MT später festgelegt wurde und enger gefasst ist, um spezifisch jüdische Identität und Tradition zu wahren.

Manuskripte
Die ältesten Manuskripte der Septuaginta enthalten Bruchstücke aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. von Leviticus, Deuteronomium, Genesis, Exodus, Numeri und den Zwölf kleinen Propheten. Komplette Manuskripte der Septuaginta stammen aus dem 4. und 5. Jahrhundert n. Chr., wie zum Beispiel der Codex Vaticanus und der Codex Alexandrinus. Diese gehören zu den ältesten nahezu vollständigen Manuskripten des Alten Testaments in einer beliebigen Sprache. Die ältesten vollständigen hebräischen Texte stammen ungefähr 600 Jahre später aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts n. Chr.
Die Differenzen zwischen den verschiedenen Handschriften der Septuaginta entstehen aufgrund jüdischer und später auch christlicher Überarbeitungen und Neubearbeitungen. Eines der bekanntesten Manuskripte ist der Codex Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert, der zahlreiche alttestamentliche Texte beinhaltet.
Die verschiedenen Versionen der Manuskripte können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie zum Beispiel Revisionen oder Fehler beim Kopieren. Die unterschiedlichen Varianten der Texte können von großer Bedeutung sein, um ein besseres Verständnis für die Entwicklung und Überlieferung der Septuaginta zu erlangen.
Die Manuskripte der Septuaginta veranschaulichen die Diversität und Veränderungen im Laufe der Zeit, die von jüdischen und christlichen Einflüssen geprägt wurden. Sie stellen bedeutende Quellen für die Erforschung dieses frühen griechischen Textes des Alten Testaments dar und ermöglichen es uns, die Geschichte und Entwicklung der Septuaginta besser nachzuvollziehen.
Septuaginta: Schlüsselausgaben im Überblick
Es gibt zahlreiche gedruckte Versionen der Septuaginta, die von verschiedenen Wissenschaftlern und Verlagen veröffentlicht wurden. Hier sind einige bekannte Beispiele:
Rahlfs‘ Septuaginta, edited by Alfred Rahlfs, was first published in 1935. This critical edition of the Septuagint is a standard reference edition and contains a detailed textual apparatus.
Die Göttinger Septuaginta ist eine umfangreiche wissenschaftliche Edition, die von einer Gruppe von Gelehrten an der Universität Göttingen herausgegeben wurde. Die erste Ausgabe wurde zwischen 1931 und 2006 veröffentlicht und enthält ausführliche Kommentare und Informationen.
Die „Cambridge Septuagint“ von Alan England Brooke, Norman McLean und Henry St. John Thackeray wurde von 1906 bis 1940 in neun Bänden herausgegeben. Es handelt sich um eine bedeutende Ausgabe mit ausführlichen Kommentaren.
Die „Oxford Edition der Septuaginta“ von Alfred Rahlfs und Robert Hanhart wurde erstmals 2006 in zwei Bänden veröffentlicht. Sie stellt einen genauen Text der Septuaginta bereit und enthält ausführliche Anmerkungen.
Die Tübinger Septuaginta wurde von Martin Hengel und Anna Maria Schwemer herausgegeben und zwischen 2008 und 2012 in sechs Bänden veröffentlicht. Diese Ausgabe stellt den griechischen Text der Septuaginta zur Verfügung und enthält detaillierte Kommentare.
Swete’s Septuagint: Edited by Henry Barclay Swete, it was first published in three volumes in 1887. It is an important early edition of the Septuagint with a detailed introduction and commentary.
Lagarde’s Septuagint: Diese Ausgabe, veröffentlicht von Paul de Lagarde im Jahr 1868, beruht auf einer neuen kritischen Textanalyse der Septuaginta.
Vaticanus Graecus 1209: Eine Schriftrolle der Septuaginta, welche im Archiv des Vatikans aufbewahrt wird. Sie stammt aus dem vierten Jahrhundert und ist eine bedeutende Ressource für die Textanalyse.
Alexandrinus Graecus 77: Ein weiteres bedeutendes Manuskript der Septuaginta aus dem 5. Jahrhundert, das in der British Library aufbewahrt wird.
Die Septuaginta-Ausgabe der Aldine Edition wurde im Jahr 1518 vom venezianischen Drucker Aldus Manutius veröffentlicht und war eine der frühesten gedruckten Ausgaben der Septuaginta.
Chronologische Ereignisaufzählung bezüglich der Septuaginta
Entstehung der Septuaginta
Die Septuaginta, die älteste erhaltene griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, wird wahrscheinlich im ptolemäischen Königreich von Juden angefertigt. Diese Übersetzung spielt eine Schlüsselrolle in der Verbreitung jüdischer Texte im griechischsprachigen Raum.
Ptolemaios II. Philadelphos und die Übersetzer
Ptolemaios II. Philadelphos, der griechische Pharaos von Ägypten, soll 72 hebräische Übersetzer beauftragt haben, die Gesetze der Juden, insbesondere den Pentateuch, ins Griechische zu übersetzen. Diese Überlieferung stammt aus dem sogenannten „Brief des Aristeas“.
Übersetzung der übrigen Bücher
Die übrigen Bücher der hebräischen Bibel, einschließlich der Propheten und Schriften, werden vermutlich ins Griechische übersetzt. Der genaue Zeitpunkt und die Verantwortlichen sind jedoch nicht eindeutig dokumentiert.
Übersetzung der Prophetenbücher
Im Laufe des 1. Jahrhunderts v. Chr. werden die prophetischen Bücher der hebräischen Bibel ins Griechische übersetzt und zur Sammlung der Septuaginta hinzugefügt.
Verwendung durch griechischsprachige Juden und frühe Christen
Die Septuaginta wird von griechischsprachigen Juden und den frühen Christen als heilige Schrift verwendet. Sie dient als Grundlage für zahlreiche Zitate im Neuen Testament.
Apostolische Verwendung
Die Autoren des Neuen Testaments zitieren in einigen Fällen aus der Septuaginta, was deren Bedeutung auch im christlichen Kontext festigt.
Origenes und seine Revisionen
Origenes, ein frühchristlicher Gelehrter, nimmt wichtige Revisionen an der Septuaginta vor. Sein Werk Hexapla wird als maßgebliche Quelle für die Textkritik des Alten Testaments betrachtet.
Codex Vaticanus
Der Codex Vaticanus, eine der ältesten nahezu vollständigen Handschriften der Septuaginta, wird angefertigt. Er wird im Vatikanischen Archiv aufbewahrt und ist eine bedeutende Quelle für die Textanalyse.
Codex Sinaiticus
Der Codex Sinaiticus, auch als Sinaiticus bezeichnet, wird im 4. Jahrhundert n. Chr. erstellt und ist einer der vier großen unzialen Codices, die einen nahezu vollständigen Text der Septuaginta und des Neuen Testaments enthalten. Die Handschrift wurde im 19. Jahrhundert von dem deutschen Bibelwissenschaftler Constantin von Tischendorf im Katharinenkloster auf der Sinaihalbinsel entdeckt. Der Codex ist von besonderer Bedeutung für die Textkritik der Bibel und hat einen hohen Stellenwert in der Wissenschaft. Ein Großteil des Manuskripts wird in der British Library in London aufbewahrt, kleinere Teile befinden sich in anderen Bibliotheken weltweit.
Hieronymos - Revisionen und Vergleiche mit dem Hebräischen
Hieronymus, ein weiterer frühchristlicher Gelehrter, zieht die hebräischen Texte für seine lateinische Vulgata-Übersetzung heran und hinterfragt die Genauigkeit der Septuaginta in einigen Fällen.
Codex Alexandrinus
Der Codex Alexandrinus, eine weitere wichtige Handschrift der Septuaginta, wird erstellt und später in der British Library in London aufbewahrt.
Septuaginta in der orthodoxen Kirche
Während die westliche Kirche die Vulgata benutzt, bleibt die Septuaginta die Standardbibelübersetzung für die orthodoxe Kirche in Ost und Byzanz.
Polyglot-Bibeln
Die Septuaginta wird in Polyglot-Bibeln wie der Complutensian Polyglot Bible (1514–1517) und der Brian Walton Polyglot (1657) veröffentlicht. Diese Ausgaben enthalten Texte in mehreren Sprachen und spielen eine Rolle in der wissenschaftlichen Bibelstudie.
Sixtinische Septuaginta
Unter der Autorität von Papst Sixtus V. wird die Sixtinische Septuaginta veröffentlicht. Diese Ausgabe basiert auf dem Codex Vaticanus.
Modernere Editionen
Robert Holmes und James Parsons (1798–1827), Constantin von Tischendorf (1850) und Henry Barclay Swete (1887–1894) veröffentlichen jeweils ihre Editionen der Septuaginta. Diese Werke prägen die textkritische Forschung.
Modernere Editionen
Robert Holmes und James Parsons (1798–1827), Constantin von Tischendorf (1850) und Henry Barclay Swete (1887–1894) veröffentlichen jeweils ihre Editionen der Septuaginta. Diese Werke prägen die textkritische Forschung.
Wissenschaftliche Editionen
- Rahlfs‘ Septuaginta (1935)
- Göttinger Septuaginta (1931–2006)
- Cambridge Septuagint (1906–1940)
- Oxford Septuagint (2006)
- Tübingen Septuaginta (2008–2012)
Aktuelle Verwendung
Die Septuaginta wird von der Orthodoxen Kirche als Grundlage für die Übersetzung des Alten Testaments verwendet. Protestanten betrachten sie oft nicht als kanonisch oder verwenden nur Teile davon. Zahlreiche Print-Editionen sind verfügbar, darunter auch moderne kritische Ausgaben.
Sophronius Eusebius Hieronymus Übersetzungen

Das Werk von Hieronymus, insbesondere die Vulgata, hat einen signifikanten Einfluss auf die christliche Theologie und insbesondere auf die Trinitätslehre. Die Vulgata ist nicht nur eine Übersetzung, sondern auch eine Interpretation des Bibeltextes, die in der römisch-katholischen Tradition eine wichtige Rolle spielt.
Trinitätslehre
Das Konzept der Trinität – Vater, Sohn und Heiliger Geist als drei Personen in einer Gottheit – ist ein Kernpunkt der christlichen Dogmatik, besonders in den westlichen Kirchen.
Comma Johanneum (1. Johannes 5:7-8)
Das sogenannte Comma Johanneum in 1. Johannes 5:7-8, das als Zusatz von Hieronymus in der Vulgata erscheint, präsentiert eine deutliche trinitarische Formulierung: „Drei sind, die im Himmel Zeugnis ablegen: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins.“ Diese Passage steht im Zentrum einer kritischen Analyse, da sie in den ältesten griechischen Manuskripten, darunter Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus aus dem 4. Jahrhundert, fehlt. Die Abwesenheit in diesen fundamentalen Textzeugen wirft die Frage der Authentizität auf.
Diese diskrepante Textüberlieferung ist nicht bloß eine akademische Kuriosität, sondern hat direkte theologische Implikationen. Die Passage dient als expliziter Beleg für die Trinitätslehre, ein Kernelement insbesondere der katholischen Theologie. Die Abwesenheit in den frühesten Manuskripten untergräbt jedoch die Argumentationsgrundlage für eine trinitarische Interpretation, die ausschließlich auf der Heiligen Schrift basiert. Die Präsenz des Comma Johanneum in späteren Manuskripten und in der Vulgata könnte als Versuch interpretiert werden, eine bereits bestehende theologische Ansicht nachträglich im biblischen Text zu verankern.
Die Konsequenz? Das Comma Johanneum kann nicht als zuverlässiger, ursprünglicher Textbestandteil der Bibel angesehen werden. Seine Funktion als vermeintlicher Beleg für die Trinitätslehre ist somit kritisch zu hinterfragen. Dies hebt die essenzielle Bedeutung der Textkritik hervor, um die Authentizität und die daraus resultierenden theologischen Schlussfolgerungen akkurat bewerten zu können.
Matthäus 28:19
Der Vers wird oft als Beleg für die Trinitätslehre angesehen, insbesondere da er die Taufformel mit den drei Personen der Trinität (Vater, Sohn und Heiliger Geist) enthält. Der griechische Text und die Vulgata stimmen in diesem Punkt überein.
Kritische Analyse
Obwohl der Vers die Namen der drei Personen der Trinität aufführt, verwendet er den Begriff „Namen“ im Singular, nicht im Plural. Dies könnte als Indiz für eine konzeptuelle Einheit der drei Personen interpretiert werden, statt als Beleg für ihre Dreieinigkeit.
Varianz in der Taufpraxis in der Apostelgeschichte
Die Taufberichte in der Apostelgeschichte zeigen, dass oft nur im „Namen Jesu“ getauft wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Taufpraxis in der Frühkirche weniger strikt trinitarisch ausgerichtet war oder dass es unterschiedliche Praktiken in verschiedenen Gemeinden gab. Die Vulgata bietet für diese Varianzen keine abschließende Klärung.
Einfluss von Hieronymus auf die Trinitätslehre
Hieronymus‘ Übersetzung hat zweifellos die Theologie der Kirche beeinflusst, insbesondere durch die Wahl bestimmter Begriffe, die dann in theologischen Debatten eine Rolle spielen. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Trinitätslehre nicht allein auf der Vulgata basiert, sondern auch auf früheren Schriften, kirchlichen Traditionen und ökumenischen Konzilen.
Exodus 3:14 und Johannes 1:1: Ein detaillierter Blick
Beide Verse spielen eine zentrale Rolle in der christlichen Theologie und haben daher spezifische Auswirkungen auf das Verständnis der Gottheit.
Johannes 1:1
Ursprüngliche Schreibweise (Griechisch): Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος
Übliche Übersetzung: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“
Kritische Analyse: Die Griechische Originalformulierung bietet Spielraum für Interpretationen. Besonders relevant sind die Artikel („ο“) und das Wort für Gott („θεος“). Je nach Übersetzung könnte der Vers auch lauten: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei dem Gott, und göttlich war das Wort.“ Die Interpretation dieser Nuancen kann signifikante Auswirkungen auf das Verständnis der Trinitätslehre und der Natur Jesu Christi haben.
Exodus 3:14
Septuaginta: Die Septuaginta übersetzt die hebräische Selbstbezeichnung Gottes als „Ego eimi ho ōn“ („Ich bin der Seiende“).
Vulgata: Hieronymus übersetzte diesen Vers in der Vulgata als „Ego sum qui sum“ („Ich bin, der ich bin“).
Analyse: Die unterschiedlichen Übersetzungen können das Verständnis der Gottheit beeinflussen. Während „Ich bin der Seiende“ eher eine Aussage über die existenzielle Natur Gottes ist, legt „Ich bin, der ich bin“ eine selbstreferenzielle, unveränderliche Qualität nahe.
Zusammenfassung
Hieronymus‘ Vulgata ist nicht nur eine Übersetzung, sondern auch eine Interpretation, die in der westlichen Kirchentradition maßgeblichen Einfluss hatte. Dies wird besonders deutlich, wenn man die feinen Nuancen der Übersetzungen in Betracht zieht, die erheblichen Spielraum für verschiedene theologische Auffassungen lassen. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, den ursprünglichen Text und seine möglichen Interpretationen sorgfältig zu analysieren, insbesondere im Kontext der Trinitätslehre.